Aus und vorbei – ist der deutsche Traum vom Finale der Fußball-Weltmeisterschaft nun schon viel zu früh. Nicht so jedoch die Debatte über die Haltung des Gastgeberlandes zu gesellschaftspolitisch brisanten Themen – wie zum Beispiel Homosexualität. Gleichgeschlechtliche Beziehungen stehen in Qatar nämlich unter Strafe. Nicht zuletzt deshalb hagelt es nun bereits seit Wochen Kritik und Boykott-Forderungen von allen Seiten. Vor allem Fifa-Chef Gianni Infantino bezeichnete die erhitzte Debatte jüngst als Symptom westlicher Arroganz, in der arabischen Welt fällt die Reaktion ähnlich aus. Sicherlich ist der entstandene Diskurs Teil einer breiteren Diskussion über die Grenzen einer – zumindest gelegentlich – wertebasierten Außenpolitik und somit auch über die internationale Zusammenarbeit mit Staaten, deren Moralvorstellungen oder Regierungsformen sich deutlich von den eigenen Prinzipien unterscheiden.
Und mit Sicherheit stößt man hier auch recht rasch auf zahlreiche Widersprüche und ein ordentliches Maß an Scheinheiligkeit. Denn: Ab wann gilt ein Staat als untragbarer Geschäftspartner? Wieso hagelt es Kritik an Qatar, wenn wir über ein Fußballturnier sprechen, nicht aber, wenn es um Energie und Wirtschaft geht? Und weshalb sah Russland sich nicht mit demselben Maß an Skepsis konfrontiert, als es vor vier Jahren die letzte Fußball-WM ausrichtete? Was bedeuten Werte in einer globalisierten Welt für Politik, Wirtschaft und Kultur auf internationaler Ebene – aber auch im Kontext unserer immer vielfältigeren Einflüssen ausgesetzten Einwanderungsgesellschaft?
Grundlegender noch ist jedoch eine andere Frage: Wie begegnet man kulturell bedingten Moralvorstellungen und Werten, die sich stark von den eigenen unterscheiden?
One size fits all oder doch maßgeschneidert?
Auf den ersten Blick scheint die Antwort banal – kulturelle Unterschiede sind da in Ordnung, wo sie nicht das Wohlergehen einzelner oder bestimmter Gruppen gefährden. Problematische Überzeugungen und Verhaltensweisen scheinen zunächst sehr leicht zu erkennen. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch schnell, dass die Realität weitaus komplexer ist. So interpretieren verschiedene Kulturen beispielsweise bereits unterschiedlich, was Wohlergehen überhaupt bedeutet. Das intrakulturelle Sozial- und Wertesystem beeinflusst unter anderem, mit welchen Träumen und Wünschen ein Mensch groß wird, ob er seine individuellen Belange denen einer größeren Gruppe unterordnet, und nicht nur, unter welchen Umständen er leidet, sondern auch, wie er seinen Schmerz verarbeitet und einordnet. Kulturen können also nur schwer miteinander verglichen und aus dem Blickwinkel anderer Kulturen verstanden – oder gar bewertet – werden. So lautet auch ein Grundsatz des sogenannten Kulturrelativismus – ein Gegenbegriff zum soziologischen Universalismus, der von einer allgemeingültigen, kulturell unabhängigen, auf alle Situationen anwendbaren Ethik ausgeht.
Erkennt man jedoch die Unübersetzbarkeit von Kultur und die Unübertragbarkeit bestimmter ethischer Begriffe und soziologischer Kategorien an, drängt sich womöglich auch schnell das Gefühl auf, man relativiere, ja, verkaufe seine eigenen Werte nahezu. Kann beispielsweise die aktuell diskutierte – vor Ort gesetzlich verankerte und im Diskurs religiös begründete – Homophobie des qatarischen WM-Botschafters mit einem einfachen Verweis auf dessen „eben einfach anderen“ kulturellen Hintergrund abgewunken werden, so wie es auch arabische Kommentatoren in den Sozialen Medien überwiegend fordern? Und wäre ein Beharren, eine weltweite Ausrichtung aller Staaten nach den eigenen Werte sollte letztlich ein unbedingt zu erreichender soziokultureller „Zielzustand“ sein, gar kulturimperialistisch und blind gegenüber den komplexen kulturellen Kontexten derartiger Überzeugungen? Schließlich genügte ein entsprechendes Sendungsbewusstsein bereits in der Vergangenheit, um die gewaltvolle Invasion und Unterwerfung fremder Länder zu rechtfertigen – einen Umstand, den besonders die aktuell so heiß diskutierte, lange von westlichen Kolonialherren beherrschte arabische Welt noch lange nicht vergessen hat. Und auch heute noch können derartige Überlegenheitsgefühle auch auf europäischem Boden in rassistischen Übergriffen und Gewalt enden. Verständlich also, dass die Kritik an Qatar bei vielen nun unangenehme Erinnerungen hervorruft und das Bedürfnis weckt, die eigene Kultur gegen ‚überhebliche‘ Fremde zu verteidigen, scheinen diese doch nichts geringeres zu fordern als ein Lossagen von vermeintlich unveränderlichen Grundprinzipien der eigenen Kultur und Religion.
Können Vorurteile überhaupt Ausdruck von Kultur sein?
Gefährlich kann jedoch auch bereits die Überzeugung sein, bestimmte Vorurteile seien fester Bestandteil des Wertekanons einer Kultur. Gründe dafür gibt es mehrere: So hat die Haltung arabisch-islamisch geprägter Völker gegenüber homosexuellem Verhalten bereits eine wechselhafte Geschichte hinter sich. Im 8. Jahrhundert erlangte der im heutigen Irak aufgewachsene Abu Nawas Bekanntheit mit – teilweise expliziten – homoerotischen Gedichten. Noch heute zählt er zu den wichtigsten klassischen Dichtern der arabischen Lyrik. Indes sah sich erst vor wenigen Monaten die libanesische Indie-Rock-Band Mashrou Leila gezwungen, ihre Auflösung bekannt zu geben. Hintergrund waren die regelmäßigen Anfeindungen, denen die Band ausgesetzt war aufgrund ihres Engagements gegen Homophobie in der arabischen Welt. Kultur ist also kein überzeitlich beständiges Sammelsurium aus klar greifbaren, ewig unveränderlichen Werten – und auch nicht unberührt von Einflüssen von außen und somit deutlich abgrenzbar von anderen Kulturen. Die Suche nach vermeintlich ‚wahrer Authentizität‘ ist somit vermutlich vergebene Liebesmüh und baut auf einem absolutistischen Weltbild auf, das die menschliche Erfahrung in fassbare, voneinander abtrennbare Kategorien unterteilt. Argumentiert man also, eine Kultur sei „eben einfach homophob“, spricht man dieser auch die Möglichkeit ab, sich jemals anders zu entwickeln. Außerdem spielt man auf diese Weise – womöglich ungewollt – in die Hände konservativer regionaler Eliten, die ebenfalls auf der Existenz eines unveränderlichen, ewig gleichen Wertekanons beharren. Ein Versuch, Verständnis zu zeigen, kann somit unfreiwillig sogar kritischen Stimmen vor Ort Schaden hinzufügen – sie werden im internationalen Diskurs nicht gehört, oder gar als verwestlichte, von Selbsthass zerfressene Gegner ihrer eigenen Kultur wahrgenommen.
Keine einfache Lösung
Letztlich gibt es wohl keine simple Antwort auf die Frage, wie man am sinnvollsten mit kulturell begründeten Werte-Unterschieden umgeht. Tatsache ist jedoch, dass die Thematik für unsere globalisierte Welt immer relevanter und den öffentlichen Diskurs somit noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Unabdingbar ist hierbei vor allem ein Gespür für die notwendige Nuance – und eine Debatte, die in Bewegung bleibt, anstatt sich mit einfachen schablonenartigen Modellen zufrieden zu geben. Unabhängig von den eigenen Überzeugungen und möglichen Träumen von einer werteuniversalistischen Weltgemeinschaft lassen sich nämlich auch kulturrelativistische Einwände nicht einfach als theoretisch-akademisches Konstrukt abwinken. Denn ganz auf dem Boden der Tatsachen muss erkannt werden: Es nützt nichts, sich diskursiv im Recht zu fühlen, wenn Angehörige einer heiß diskutierten Kultur diese Perspektiven von außen ablehnen. Kulturrelativismus ist somit nicht nur eine – möglicherweise in Teilen naive – Kritik des Universalismus, sondern auch eine reale Forderung und Teil der Wirklichkeit, innerhalb derer wir uns mit unserer Debatte bewegen. Anstatt also mit breiten Pinselstrichen zu fordern und zu verurteilen, sollten wir vielleicht auch öfter innehalten – weniger über andere Kulturen reden und viel mehr mit ihnen. Oder: auch einfach einmal zuzuhören. Was wir finden, könnte überraschen.


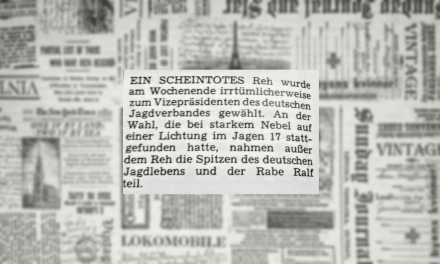


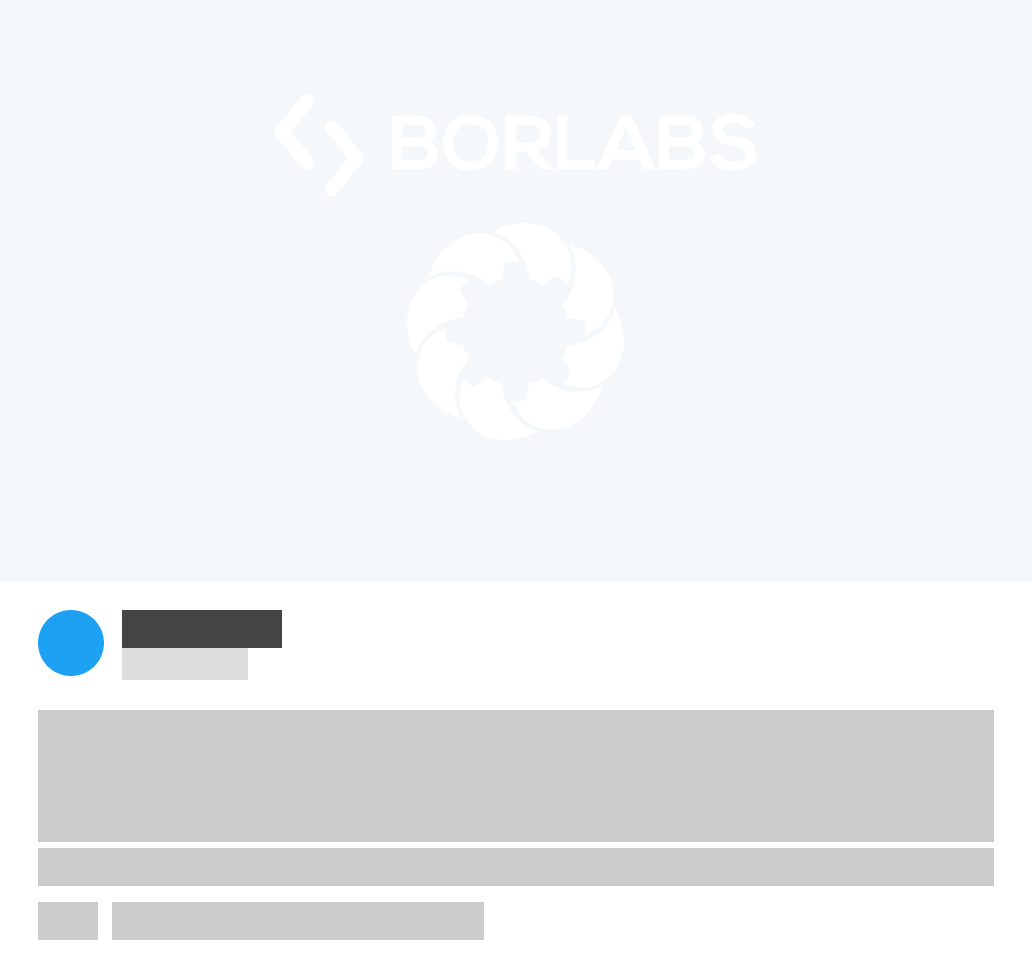
Wieder einmal greift The Late Modern ein aktuelles Thema auf und trägt dann Schicht um Schicht ab, um zu den grundsätzlichen Fragen vorzustoßen. Und das mit großer Klarheit und bestechender Logik. Dass keine einfache Lösung angeboten werden kann, versteht sich dann fast von selbst. Innehalten, zuhören und das Gehörte auf sich wirken lassen kann in der Tat Wirkungen entfalten, auf die man nicht vorbereitet ist. Dies aufzuzeigen ist ein großes Verdienst.